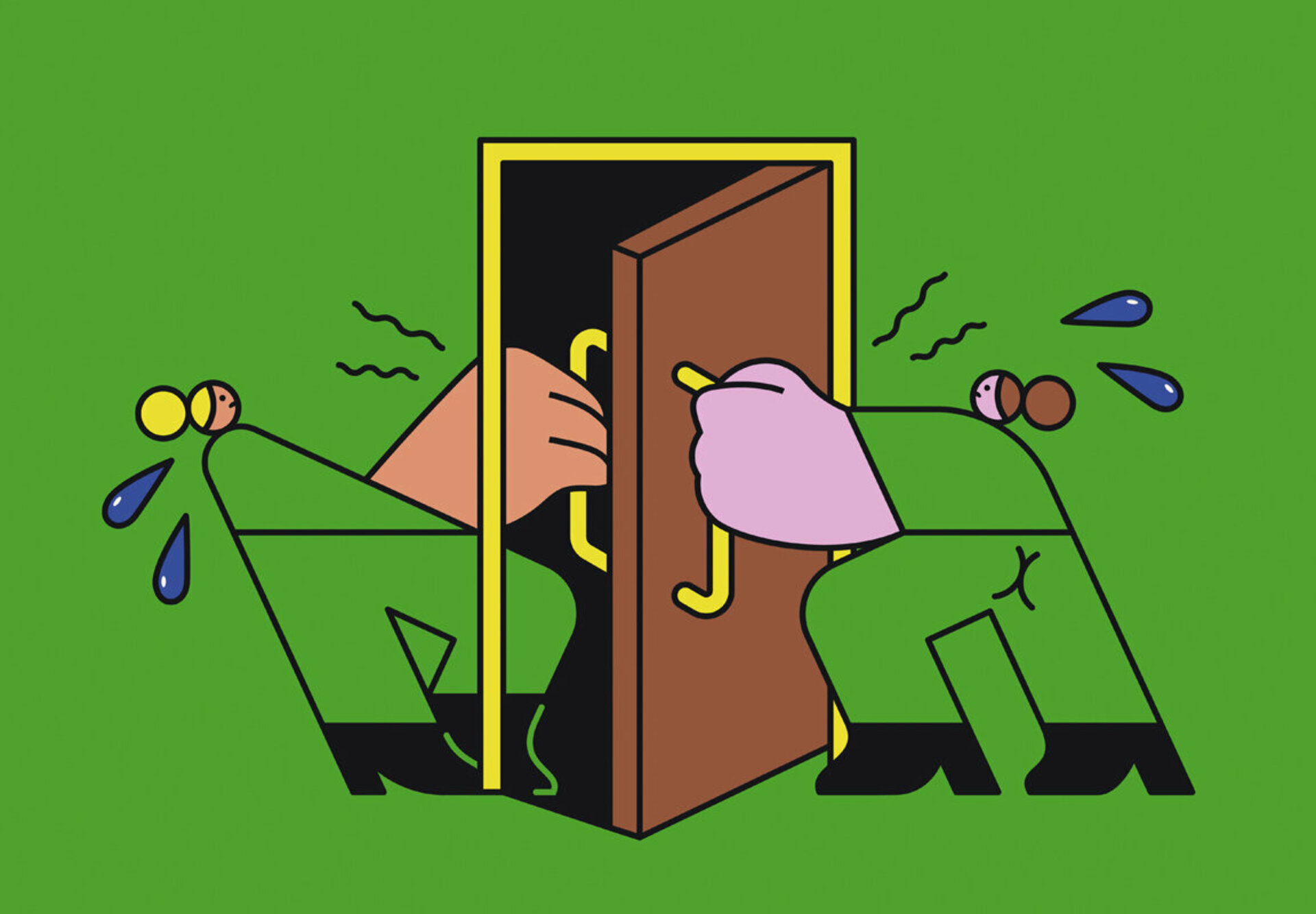Über 30 Jahre ist es her, dass der US-Politikwissenschaftler Francis Fukuyama das Ende der Geschichte ausrief: Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sah es für ein paar Jahre so aus, als habe der Liberalismus über alle Ideologien gesiegt, als hätten sich Demokratie und Marktwirtschaft durchgesetzt und würden die Erde nach und nach zu einem Ort des Friedens, der Freiheit und des Wohlstands machen.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist klar: Der Mann hat sich geirrt. Wir leben in einer Zeit des Unbehagens, die Welt scheint aus den Fugen: Klimakrise, rechter Terrorismus, linke Randale, islamistische Anschläge, antisemitische Übergriffe, digitale Überwachung, weltweite Flüchtlingsströme und jetzt auch noch die Corona-Pandemie. Obwohl die Welt mit der Abwahl Donald Trumps als US-Präsident ein Problem weniger hat, werden unsere freiheitlichen Werte weiter auf die Probe gestellt werden, weil die Konflikte unserer Zeit fast alle aus Fehlern resultieren, die in der Vergangenheit liegen, sei es der Kolonialismus mit seinen außen- und migrationspolitischen Folgen oder der immer wieder aufgeschobene Kampf gegen die Klimakrise.
Erinnert sich eigentlich noch jemand an die Spaßgesellschaft der Neunziger Jahre? Damals ging die Angst um, dass wir vor lauter Wohlstand und Sicherheit zu vergnügungssüchtigen Egoistinnen und Egoisten werden, dass wir uns „zu Tode amüsieren“. Vor zu viel Hedonismus muss sich heute niemand mehr fürchten. Und Jugendliche treffen sich schon lange nicht mehr zum Komasaufen, sondern um gegen die Klimakrise zu demonstrieren.
Und das ist die positive Nachricht in dem Schlamassel: Wenn Menschen an eine Grenze gelangen, stehen die Zeichen günstig für neue Erkenntnisse. Auf einmal sieht man die Dinge klar wie lange nicht: welche Chancen vertan, welche Fehler gemacht, welche Entscheidungen hinausgezögert wurden – aber vor allem: was nun zu tun ist. Wenn dann noch der Mut dazukommt, die neuen Erkenntnisse auch umzusetzen, ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass die Dinge nachher besser sein werden, als sie vorher je waren.
Mut – das sagt sich so leicht, was für ein unscheinbares Wörtchen. „Sei doch mal mutig“, ist ein Satz, den man oft hört. Er beinhaltet die Aufforderung, das Risiko einzugehen, Dinge anders als sonst zu machen, das Terrain, auf dem man sich sicher fühlt, zu verlassen, um neue Erfahrungen zuzulassen. Auf die Politik bezogen war die Idee eines vereinten Europas so ein mutiger Entschluss: Im Jahr 1952 entstand die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, um in einem von Misstrauen geprägten Klima für Frieden und Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu sorgen. Frankreich und Deutschland sollten nach zwei verheerenden Weltkriegen ein starkes Europa aufbauen – ein Bollwerk freiheitlich-demokratischer Werte; zum ersten Mal gaben Nationalstaaten einen Teil ihrer Souveränität an eine supranationale Organisation ab. „Alles Große ist ein Wagnis“, sagte damals Bundeskanzler Konrad Adenauer. „Auch die Gründung eines neuen Europas ist kein risikofreies Unternehmen.“