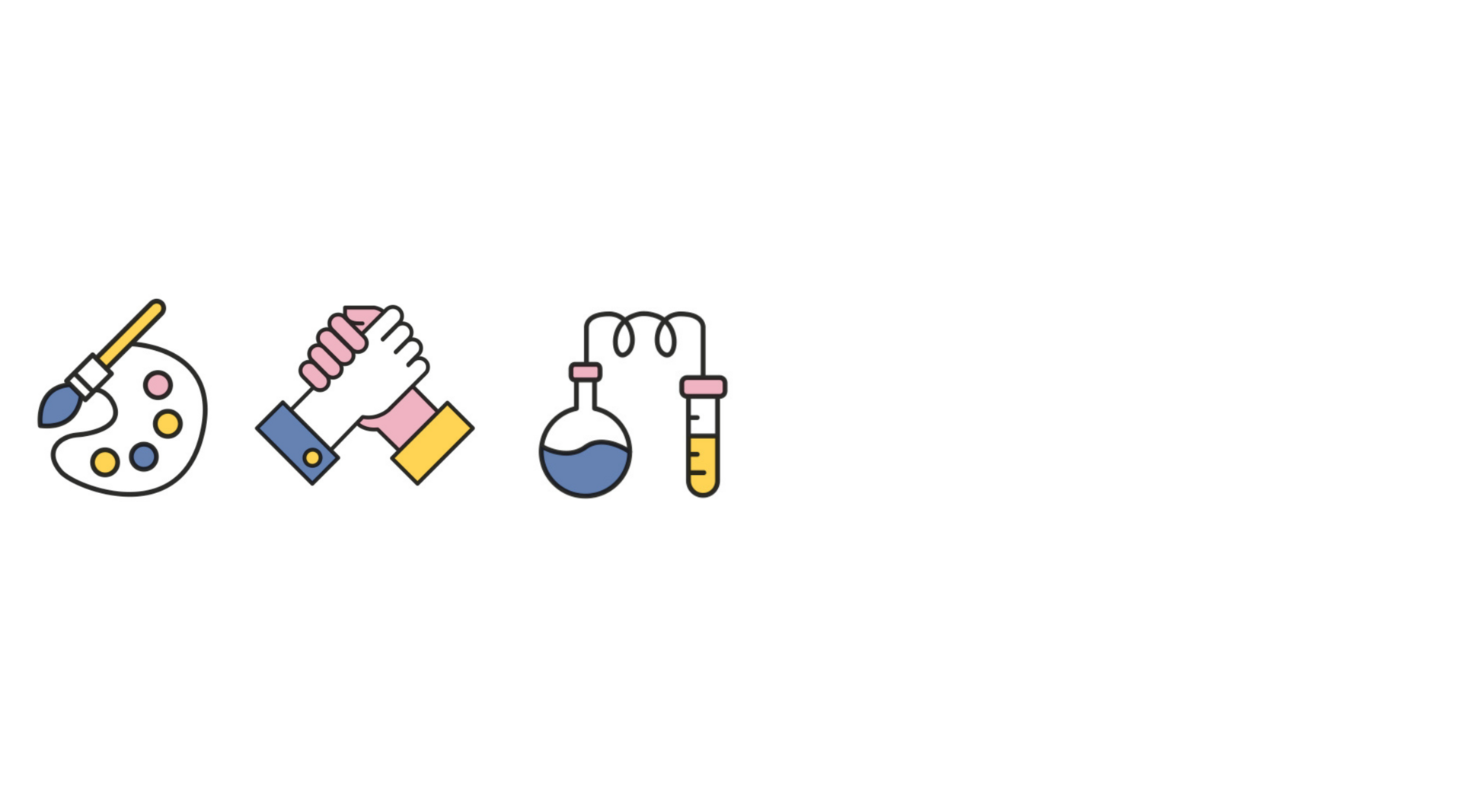Mehr lachen
Kinder lachen bis zu 400-mal am Tag, Erwachsene nur noch 15- bis 20-mal, belegen Studien. Dabei ist Lachen gesund: Es aktiviert 300 Muskeln am ganzen Körper. Die Atmung wird intensiviert, der Körper mit Sauerstoff geflutet. Das Gehirn schüttet Glückshormone aus, dafür sinken die Stresshormone. Sogar das Immunsystem wird durch Lachen gestärkt. Die gute Nachricht für Erwachsene: Wer mit Kindern zusammen ist, lacht häufiger.